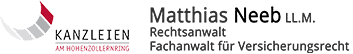Berufsunfähig nach Krebserkrankung: So wehren Sie sich gegen die Versicherung
Eine Krebsdiagnose bedeutet für Betroffene nicht nur eine enorme gesundheitliche Belastung. Auch die Frage, ob und wie der bisherige Beruf weiter ausgeübt werden kann, rückt schnell in den Mittelpunkt. Viele Patienten kämpfen nach Operationen, Chemotherapien oder Bestrahlungen mit Langzeitfolgen wie Fatigue, Schmerzen oder Konzentrationsproblemen.
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) soll in solchen Fällen finanzielle Sicherheit bieten. Doch die Praxis zeigt: Versicherer lehnen Anträge häufig ab oder verzögern Zahlungen. Für Erkrankte, die ohnehin geschwächt sind, wird die zusätzliche Unsicherheit zur zweiten großen Belastung.

Haben Sie offene Fragen oder benötigen Sie rechtliche Unterstützung zum Thema Berufsunfähig nach Krebserkrankung? Kontaktieren Sie mich telefonisch unter 02 51 / 42 48 3 oder per E-Mail an: neeb@kanzleien-am-hohenzollernring.de
In diesem Beitrag erfahren Sie, wann Sie berufsunfähig nach Krebserkrankung werden, welche Schwierigkeiten im Umgang mit Versicherungen typisch sind, wie Sie Ihre Ansprüche nachweisen können und warum juristische Unterstützung entscheidend ist.
Sie brauchen rechtliche Unterstützung?
Wenden Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen an unsere spezialisierte Kanzlei. Als Fachanwalt für Versicherungsrecht bin ich auf Fälle im Bereich Berufsunfähigkeit spezialisiert und helfe Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie einfach meine BU-Kanzlei für ein Erstgespräch.
1. Was bedeutet Berufsunfähigkeit nach Krebs?
Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf voraussichtlich dauerhaft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben können. Entscheidend ist dabei nicht allein die Krebsdiagnose, sondern die konkreten Auswirkungen der Erkrankung auf Ihre Arbeitsfähigkeit.
Krebserkrankungen können unterschiedlich starke körperliche und psychische Einschränkungen hinterlassen. Häufige Folgen sind anhaltende Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, körperliche Schwächen oder Beschwerden durch Therapie-Nebenwirkungen. Ob eine Rückkehr in den Beruf möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab: der Art und Schwere der Erkrankung, dem individuellen Heilungsverlauf sowie den Anforderungen Ihres Berufs.
Juristisch betrachtet definiert § 172 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dass Berufsunfähigkeit vorliegt, wenn der Versicherte infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls seinen zuletzt ausgeübten Beruf voraussichtlich dauerhaft zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben kann. Für Versicherungsnehmer bedeutet dies, dass nicht die Diagnose an sich, sondern die tatsächliche Einschränkung bei der beruflichen Tätigkeit ausschlaggebend ist.
Fallbeispiel:
Ein Außendienstmitarbeiter erkrankte an einem Lymphdrüsentumor. Nach der Behandlung litt er unter dauerhafter Erschöpfung und Konzentrationsproblemen. Die Durchführung von Kundenterminen und Geschäftsreisen war nicht mehr möglich. Obwohl sein Arzt die Einschränkungen attestierte, stellte die Versicherung zunächst die Dauerhaftigkeit infrage. Erst ein unabhängiges Gutachten bestätigte, dass eine Rückkehr in den Beruf nicht zumutbar war, und die Berufsunfähigkeit wurde anerkannt.
2. Typische Probleme mit der BU-Versicherung
Versicherer prüfen Leistungsanträge bei einer Krebserkrankung besonders gründlich. Das liegt zum einen daran, dass Krebs eine der häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit ist und damit für die Versicherungen hohe Kosten entstehen können. Zum anderen versuchen die Gesellschaften, ihr finanzielles Risiko durch strenge Prüfungen möglichst gering zu halten. Für die Versicherten bedeutet das aber oftmals einen zusätzlichen Kampf – neben der ohnehin belastenden Erkrankung.
Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Einschränkungen
Ein zentrales Problem ist, dass die Dauerhaftigkeit der Einschränkungen oft infrage gestellt wird. Selbst wenn Fachärzte attestieren, dass ein Patient seinen Beruf dauerhaft nicht ausüben kann, argumentiert die Versicherung häufig, dass Therapien noch nicht abgeschlossen seien oder sich der Gesundheitszustand verbessern könnte.
Hinzu kommen eigene Gutachten der Versicherung, die oft zu abweichenden Ergebnissen kommen und Beschwerden nicht im vollen Umfang anerkennen. Die persönliche Lebensrealität, wie ständige Erschöpfung oder Konzentrationsprobleme, wird dabei häufig kaum berücksichtigt.
Anzeigepflichten und angeblich zumutbare Alternativen
Hinzu kommt die Berufung auf vermeintliche Anzeigepflichtverletzungen. Schon kleine Ungenauigkeiten bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen im Antrag können den Versicherer veranlassen, die Leistung abzulehnen oder vom Vertrag zurückzutreten. Häufig wird argumentiert, dass frühere Beschwerden oder Arztbesuche verschwiegen wurden, auch wenn diese in keinem unmittelbaren Zusammenhang zur späteren Krebserkrankung stehen. Viele Versicherungsnehmer fühlen sich dadurch zu Unrecht kriminalisiert.
Ein weiteres Standardargument lautet, dass dem Versicherten zumutbare Tätigkeitsalternativen offenstehen. Gemeint ist damit, dass er zwar seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber auf eine andere, „leichtere“ Tätigkeit verwiesen werden könne. Ob eine solche Tätigkeit tatsächlich existiert und ob sie der beruflichen Qualifikation entspricht, spielt dabei oft eine untergeordnete Rolle. In der Praxis bedeutet das für die Betroffenen, dass ihre berufliche Lebensleistung nicht ausreichend gewürdigt wird. Letztlich hängt dies von den im Vertrag vereinbarten Bedingungen ab.
Folgen für die Betroffenen
Die Strategien der Versicherer führen oft zu langwierigen Verfahren, bei denen Betroffene monatelang auf eine Entscheidung warten. Während dieser Zeit fällt das Einkommen aus, während laufende Kosten wie Miete, Kredite oder Unterhalt weiter anfallen – eine zusätzliche Belastung in ohnehin schwierigen Zeiten.
Frühzeitige professionelle Unterstützung ist deshalb entscheidend. Ein erfahrener Fachanwalt für Versicherungsrecht kennt die typischen Taktiken der Versicherer und kann gezielt dagegen vorgehen, um die Ansprüche wirksam durchzusetzen.
3. Nachweis der Berufsunfähigkeit
Um Ansprüche erfolgreich durchzusetzen, ist eine sorgfältige Dokumentation entscheidend. Versicherte sollten daher umfassende Unterlagen vorlegen, die die Schwere und Dauerhaftigkeit der Einschränkungen klar belegen. Dazu gehören insbesondere:
- Ärztliche Atteste und Befundberichte, die die Einschränkungen detailliert beschreiben. Diese sollten nicht nur Diagnosen enthalten, sondern auch konkrete Angaben zu funktionellen Beeinträchtigungen, Symptomen im Alltag und Prognosen zur weiteren Entwicklung.
- Eine präzise Tätigkeitsbeschreibung, die zeigt, welche Anforderungen der Beruf mit sich bringt. Hierbei sollten sowohl physische als auch geistige Aufgaben und typische Belastungen im Arbeitsalltag dokumentiert werden, damit der Versicherer genau nachvollziehen kann, warum eine Ausübung des Berufs nicht mehr möglich ist.
- Nachweise über Therapieverläufe, Nebenwirkungen und Prognosen, wie beispielsweise Berichte über Chemotherapie, Operationen, Reha-Maßnahmen oder ärztliche Empfehlungen. Diese Unterlagen zeigen, dass trotz optimaler Behandlung die Einschränkungen dauerhaft bestehen.
Fallbeispiel:
Eine Verwaltungsangestellte, die an Brustkrebs erkrankte, konnte nach der Behandlung wegen chronischer Erschöpfung und kognitiver Probleme nicht mehr zuverlässig arbeiten. Ihr Antrag auf BU-Rente wurde zunächst abgelehnt, mit der Begründung, eine vollständige Genesung sei möglich. Erst ein zusätzliches medizinisches Gutachten, das die dauerhaften Einschränkungen klar dokumentierte, führte dazu, dass die BU-Rente bewilligt wurde.
Eine umfassende und gut dokumentierte Unterlagenlage ist entscheidend, um die oft strenge Prüfung der Versicherung zu bestehen. Sie erhöht die Erfolgschancen und beschleunigt die Bearbeitung des Antrags erheblich.
4. Staatliche Leistungen im Vergleich
Neben der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung können Betroffene auch auf staatliche Leistungen zurückgreifen. Das Krankengeld nach § 44 SGB V wird gezahlt, sobald die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers endet, und kann bis zu 78 Wochen gewährt werden. Es beträgt üblicherweise 70 % des Bruttogehalts, maximal 90 % des Nettogehalts.
Nach Ablauf des Krankengeldes kann eine Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI beantragt werden. Hierbei wird nicht berücksichtigt, welchen Beruf der Betroffene zuletzt ausgeübt hat, sondern ob er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch drei oder sechs Stunden täglich arbeiten kann. Die Leistungen sind in der Regel deutlich niedriger als die einer privaten BU-Rente, die den konkreten Beruf absichert.
Wer darüber hinaus keine weiteren Ansprüche hat, ist oft auf Grundsicherung angewiesen. Diese richtet sich nach Einkommen und Vermögen und deckt in der Praxis nur das Existenzminimum ab. Für viele Betroffene bedeutet das einen erheblichen Einschnitt im Lebensstandard – ein Umstand, der die Bedeutung einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung deutlich unterstreicht.
5. Unterstützung durch einen Fachanwalt
Viele Versicherungsnehmer stoßen allein schnell an Grenzen. Versicherungen nutzen komplexe Vertragsbedingungen, medizinische Gegengutachten und Verzögerungstaktiken, um die Auszahlung von Leistungen zu verzögern oder abzulehnen. Betroffene, die versuchen, den Antrag ohne Unterstützung durchzusetzen, fühlen sich oft überfordert und akzeptieren manchmal unzureichende Angebote oder Verzögerungen.
Ein Fachanwalt für Versicherungsrecht, wie Matthias Neeb, kann hier entscheidend helfen. Er prüft Ihre Unterlagen und Verträge sorgfältig, übernimmt die Kommunikation mit der Versicherung und erstellt eine fundierte Begründung Ihrer Ansprüche. Darüber hinaus kann er unabhängige Gutachten einholen und, falls nötig, Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen. Mit professioneller juristischer Unterstützung steigen die Chancen deutlich, dass Sie die vertraglich vereinbarten Leistungen auch tatsächlich erhalten.
6. Fazit: Das Wichtigste im Überblick
Eine Krebserkrankung kann eine dauerhafte Berufsunfähigkeit nach sich ziehen. Versicherungen verweigern jedoch oft die Zahlung oder verzögern diese.
- Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der zuletzt ausgeübte Beruf zu mindestens 50 % dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann.
- Versicherer bestreiten häufig die Dauerhaftigkeit oder argumentieren mit Anzeigepflichtverletzungen.
- Mit fachanwaltlicher Unterstützung steigen die Chancen, die vereinbarte BU-Rente durchzusetzen.
7. FAQ
Wann bin ich nach einer Krebserkrankung berufsunfähig?
Wenn Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf voraussichtlich dauerhaft zu mindestens 50 % nicht mehr ausführen können.
Reicht die Krebsdiagnose allein für den BU-Anspruch?
Nein. Entscheidend ist, ob die Erkrankung dauerhaft die Arbeitsfähigkeit im konkreten Beruf einschränkt.
Welche Unterlagen brauche ich für den Antrag?
Ausführliche ärztliche Befunde, Atteste und eine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung.
Was tun, wenn die Versicherung ablehnt?
Widerspruch einlegen und fachanwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, notfalls Klage erheben.
Wie unterstützt ein Fachanwalt?
Er prüft Ihren Vertrag, besorgt fehlende Unterlagen, kommuniziert mit der Versicherung und setzt Ihre Ansprüche auch vor Gericht durch.
Bildquellennachweis: Pixelshot | Canva.com
Rufen Sie uns jetzt an unter 02 51 / 42 48 3 oder schreiben Sie eine Mail an neeb@kanzleien-am-hohenzollernring.de.
Ähnliche Artikel
Über den Autor: Matthias Neeb